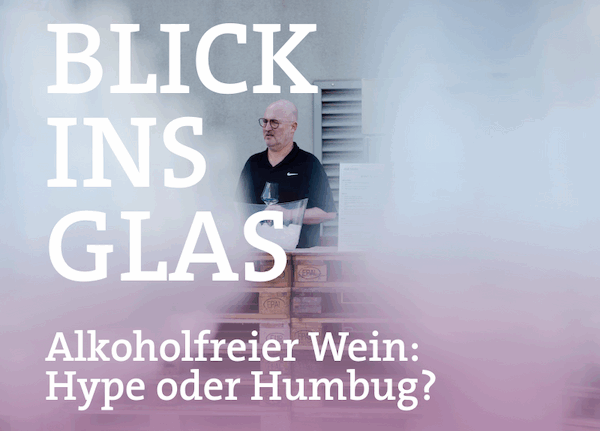Harte Zeiten für Weinhändler. Vor allem für diejenigen, die ihre Leidenschaft darin sehen, außergewöhnliche Weine aufzuspüren – Weine, die so gut sind, dass das Genießen Sinn ergibt. (Es sei denn, man möchte sich schlicht betrinken …)
Derzeit verändert sich jedoch der Markt. Es wird weniger Wein getrunken. Persönlich finde ich das gar nicht schlecht. Denn Wein enthält nun mal Alkohol – und damit sollte man bewusst umgehen.
Doch der Trend geht nicht nur zu weniger Wein, sondern auch in Richtung alkoholfreier Varianten. Kaum zu glauben: „Alkoholfreier Wein“ ist aktuell der meistgesuchte Weinbegriff bei Google. Dabei handelt es sich in Wahrheit um entalkoholisierten Wein – ein Getränk, das fast immer kleine Mengen Restalkohol enthält. Und genau da beginnt schon die Diskussion: Für wen ist das eigentlich gedacht? Für Muslime? Für trockene Alkoholiker? Für Schwangere? Für Kinder? Fragen über Fragen …
Um alkoholfreien Wein herzustellen, braucht es zunächst einmal Wein. Dieser entsteht klassisch, indem süßer Traubenmost durch Gärung zu trockenem Wein wird – eine Jahrtausende alte Technik. Manche Winzer fügen danach noch eine zweite Gärung hinzu, die sogenannte malolaktische Fermentation. Soll der Wein alkoholfrei werden, muss der Alkohol anschließend entfernt werden. Dafür gibt es verschiedene technische Verfahren.
Und genau hier liegt für mich das Problem: Das Ganze ist eben hochgradig technisch. Für mich verliert ein entalkoholisierter Wein dadurch seine Seele. Er wirkt weniger wie ein echtes, handwerklich geprägtes Genussmittel – sondern wie ein industrielles Produkt. In den meisten Fällen schicken Winzer ihren Wein ins Entalkoholisierungszentrum. Dort wird der Alkohol entzogen, dabei gehen Aromen verloren, die dann künstlich zurückgeführt werden. Und schon stellt sich das nächste Problem: Alkohol wirkt im Wein auch konservierend. Ohne ihn muss stabilisiert werden – häufig mit Zusätzen wie Dimethyldicarbonat (E242), Ethyllaurylarginat (E243), Kohlendioxid, L-Ascorbinsäure oder Gummiarabicum. Wollen gesundheitsbewusste Konsumenten das wirklich trinken?
Auf der letzten ProWein-Messe haben wir uns quer durch unzählige entalkoholisierte Weine probiert. Mein Fazit: ernüchternd – und nicht im positiven Sinne. Viele rochen unangenehm, manche erinnerten sogar an Erbrochenes. Die meisten schmeckten unausgewogen, leer, unharmonisch. Und dann die Nährwerte: Ein großer Teil dieser Weine wies Zuckerwerte zwischen 35 und 79 Gramm pro Liter auf – also im Bereich einer satten Spätlese. Mir ist das schlicht zu viel. Ihnen auch?
Hinzu kommt: Entalkoholisieren ist teuer. Das Verfahren kostet Geld, und der Winzer muss es auf den Preis aufschlagen. So ist die alkoholfreie Version oft sogar teurer als das Original.
Ehrlich gesagt: Ich ringe noch damit, den Sinn dieser Entwicklung nachzuvollziehen. Für mich persönlich gibt es bessere Alternativen:
- Einfach keinen Alkohol trinken – und stattdessen auf hochwertiges Wasser setzen. Ich schwöre auf Plose: klar, frisch, wie ein Schluck aus der Bergquelle. Für mich um Welten genussvoller als jeder alkoholfreie Wein.
- Oder man trinkt weniger, dafür aber wirklich guten Wein. So halte ich es derzeit – und es schmeckt himmlisch. Gleichzeitig lebe ich bewusster.
- Oder man greift zum Klassiker: der guten alten Weinschorle. Ein trockener Riesling, kombiniert mit spritzigem Mineralwasser – fertig ist ein herrlich leichtes, erfrischendes Weingetränk mit wenig Alkohol.
Vielleicht kommt meine Abneigung gegen entalkoholisierten Wein auch daher, dass ich fermentierte Lebensmittel liebe. Sojasauce, Kimchi, Nuoc-mam, Gochujang – all das steht bei mir regelmäßig auf dem Tisch. Es ist lebendig, gesund, voller Geschmack. Und wahrscheinlich ist es genau dieser Fermentationszauber, der auch guten Wein für mich so unwiderstehlich macht.
Ich selbst trinke inzwischen seltener – aber wenn, dann bewusster und besser. Sobald ich die Wirkung von Alkohol spüre, höre ich auf. Parallel habe ich meine Ernährung umgestellt: Zucker und Kohlenhydrate reduziere ich, weil sie mir nicht guttun. Davon möchte ich möglichst wenig zu mir nehmen.
Am Ende bleibt für mich die Erkenntnis: Lieber seltener, aber richtig guten Wein genießen – statt Kompromisse einzugehen.
Ihr
Oliver Schmid
 viDeli Magazin
viDeli Magazin